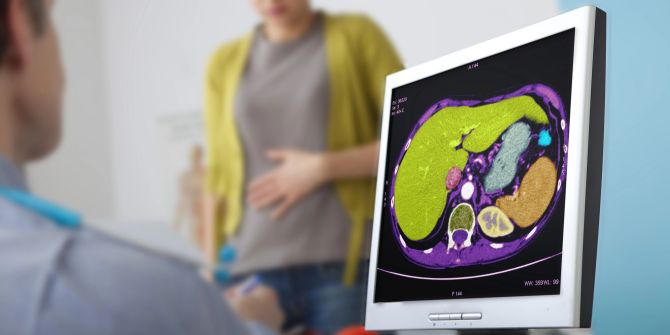ALS bei Frauen – Risikofaktoren und Symptome

Frauen erkranken tendenziell seltener an der Amyotropher Lateralsklerose (ALS). Hormonelle Einflüsse spielen bei dem Ausbruch eine grosse Rolle.

Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft Männer etwa 20 Prozent häufiger als Frauen. Die Erkrankung tritt typischerweise zwischen dem 40. und 70. Lebensjahr auf.
Im Vergleich zu Männern gibt es Hinweise darauf, dass hormonelle Einflüsse und frauenspezifische Erkrankungen das Risiko für ALS bei Frauen beeinflussen können. Geschlechtshormone wie Östrogen und Progesteron scheinen einen schützenden Effekt zu haben.

Frauen, die früh in die Wechseljahre kommen, könnten daher ein erhöhtes Risiko für eine frühere ALS-Erkrankung haben. Hinzu kommen weitere altersbedingte Veränderungen, beispielsweise eine Zunahme von Entzündungsprozessen, Gefässproblemen und Stoffwechselstörungen, die ebenfalls das Risiko für ALS erhöhen können.
Nervenzellen büssen Funktionstüchtigkeit ein
ALS schädigt und zerstört die Motoneuronen, die Nachrichten vom Gehirn zu den Muskeln übertragen. Wenn diese Nervenzellen nicht mehr funktionieren, können die Muskeln keine Signale mehr empfangen.
Die betroffenen Muskeln werden schwach, steif und bauen sich allmählich ab. Schliesslich hören sie ganz auf zu arbeiten, was eine komplette Lähmung zur Folge hat.
Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsgesundheit bleiben bei Frauen mit ALS unbeeinträchtigt. Schwangerschaften sind möglich und verlaufen meist ohne Komplikationen, da die Gebärmutter nicht betroffen ist.
Nur selten spielen genetische Faktoren eine Rolle
Die meisten ALS-Fälle sind sporadisch und treten ohne familiäre Vorgeschichte auf. Nur etwa fünf bis zehn Prozent der Fälle sind erblich bedingt und werden als familiäre ALS bezeichnet.

Mutationen in bestimmten Genen können zur Krankheitsentstehung beitragen. Diese Veränderungen stören die normale Funktion wichtiger Proteine im Körper.
Umweltfaktoren spielen besonders bei Frauen eine bedeutende Rolle. Schadstoffe können das Hormonsystem beeinträchtigen und zu einem früheren Krankheitsbeginn führen.
Frauen zeigen meist andere Symptome
Frauen weisen häufiger einen bulbären Beginn auf, der zunächst Gesicht und Hals betrifft. Männer dagegen haben eher einen spinalen Beginn, bei dem Schwäche und Muskelschwund zunächst an den Gliedmassen auftreten.
Frühe Anzeichen können einseitig auftreten und sind oft subtil. Dazu gehören Muskelschwäche, undeutliche Sprache und Schwierigkeiten beim Schlucken.
Im fortgeschrittenen Stadium betrifft die Krankheit beide Körperseiten und alle willkürlichen Muskeln. Das Gehirn bleibt meist intakt, es sei denn, es liegt zusätzlich eine frontotemporale Demenz vor.
Lebenserwartung ist stark reduziert
Die Lebenserwartung nach der Diagnose beträgt im Allgemeinen zwei bis fünf Jahre. Einige Frauen können jedoch auch zehn Jahre oder länger mit der Krankheit leben.

Die Prognose hängt stark von der individuellen Ausprägung und dem Schweregrad ab. Eine frühe Diagnose und Behandlung können die Lebensqualität erheblich verbessern.
Eine Heilung gibt es noch nicht
Die Behandlung von ALS zielt darauf ab, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die Selbstständigkeit und Kommunikationsfähigkeit der Betroffenen zu erhalten. Das einzige zugelassene Medikament, Riluzol, kann den Abbau der Nervenzellen etwas bremsen und so das Leben um einige Monate verlängern.
Zur Unterstützung kommen verschiedene symptomatische Therapien zum Einsatz, wie Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Medikamente helfen gezielt gegen Muskelkrämpfe, Spastik, Schmerzen oder übermässigen Speichelfluss und werden individuell angepasst.
Bei fortschreitender Erkrankung sind oft Atemhilfen, Ernährungssonden sowie psychologische Begleitung und palliative Massnahmen nötig, um Beschwerden wie Atemnot und Angst zu lindern. Die Behandlung ist immer individuell und erfolgt durch ein spezialisiertes Team, da eine Heilung bis heute nicht möglich ist.